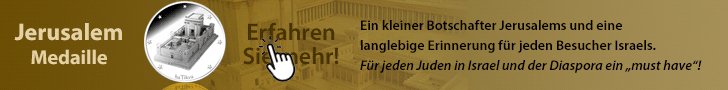
Ein Gespräch mit Angelika Brosig
von Christel Wollmann-Fiedler
Berlin
C.W.-F.: Den Jüdischen Friedhof in Schopfloch habe ich vor Wochen zum ersten Mal besucht und merkte, dass er gut versorgt wird. Wann hast Du Dich in die Arbeit gestürzt und begonnen Dich um ihn zu kümmern?
A.B.: Vor fünf Jahren. Durch den Besuch einer Freundin bin ich draufgekommen, dass sich niemand um den Friedhof kümmert. Zuerst habe ich mich über die Situation des Friedhofs informiert und wollte wissen, was es zu tun gibt.
C.W.-F.: Im 16. Jahrhundert wurde der Friedhof angelegt und die Steine werden durch die Feuchtigkeit regelrecht gefressen und zerstört.
A.B.: Ja, vor allem im unteren Bereich, wo sich das Wasser staut. An der Hanglage ist das Problem nicht so groß, sondern wirklich nur in dem unteren linken Teil, wo die Verstorbenen regelrecht „schwimmen“ und nicht ruhen. Im Alten Teil sind die Jurakalksteine stabil, doch im Neuen Teil wurden Sandsteine und die um Neunzehnhundert in Mode gekommenen Kunstbetonsteine verwendet, die sehr gefährdet und bruchanfällig sind. Auch die Dauerbeschattung im Sommer durch die Bäume fördert auch die Feuchtigkeit der Grabsteine.
C.W.-F.: Was bedeutet das für Deine Arbeit, dem Fass ohne Boden?
A.B.: Ich bin für die Politik der kleinen Schritte und habe im Jahr 2006 systematisch angefangen zu arbeiten, nachdem der Friedhof von Architekten planerisch erfasst worden ist. Von Stein zu Stein bin ich gegangen und habe versucht zu entziffern, habe die hebräischen Zeilen gezählt. Hebräisch kann ich leider nicht. Dann habe ich begonnen, die Steine Reihe für Reihe zu fotografieren.
C.W.-F.: Im Internet sah ich, dass die Steine dokumentiert sind. Deine Freundin, die Steinmetzmeisterin Birgit Hähnlein-Heberlein, restaurierte bereits einige Steine sehr liebevoll zu einem ganz geringen Preis. Vorhin habe ich mir das noch mal angeschaut. Du hast die Schriften vom Hebräischen ins Deutsche übersetzen lassen. Das kostet doch einen Haufen Geld?
A.B. Das Wunder des Friedhofsprojektes ist, daß ich immer Menschen fand und finde, die ohne Profit und umsonst mit mir arbeiten. Zum einen hat mir vom „Harburg Projekt“ Rolf Hubmann geholfen beim Entziffern der deutschen Inschriften. Als wir dann 250 Namen alphabetisch ins Internet gestellt haben, kamen begeisterte Reaktionen aus aller Welt. Dadurch lernte ich Rabbiner Shapiro aus Jerusalem kennen, der mir seine Hilfe anbot. Er hat ohne Finanzierung 140 Grabsteine vom Hebräischen ins Englische übersetzt und ich dann ins Deutsche. Das ging sehr gut per Foto und Internet.
C.W.-F.: Wie viele Grabsteine sind denn überhaupt auf diesem Friedhof?
A.B.: Ca. 1200 Steine. Die Architekten hatten eine an der Zahl bestimmt, doch sie stimmte nicht. Viele kleinere Steine wurden übersehen, die ich dann auch aufgenommen und nummeriert habe.
Die Restaurierungsarbeiten haben sich ganz zufällig ergeben als ich erfuhr, dass man diese Möglichkeit wahrnehmen darf auf einem stillgelegten Jüdischen Friedhof. Durch den Kontakt mit Sigrid Ansbacher aus den USA, die den Grabstein ihrer Großmutter restaurieren lassen wollte, fing das an. Vor Jahren sah sie, dass der Stein und der Sockel in einem schlechten Zustand sind. Als ich im Landesverband anfragte, ob wir „Nicht-Angehörige“ auch Steine restaurieren lassen dürfen, erhielt ich eine positive Antwort. So gründete ich das „Stein-Paten-Projekt“ zur Rettung der Steine für Interessierte von hier und für die restlichen jüdischen Angehörigen.
C.W.-F.: Wer ist Sigrid Ansbacher?
A.B.: Sigrid Ansbacher ist zweiundachtzig Jahre alt und eine der vier jüdischen Überlebenden von Dinkelsbühl. Ebenso ihr siebenundachtzigjähriger Bruder Manfred Anson aus den USA, und ihre beiden Geschwister, der dreiundachtzigjährige Benjamin und die siebenundachtzigjährige Margot Sommer, die in Israel leben.
C.W.-F.: Das war eigentlich meine nächste Frage. Du korrespondierst mit einigen und hast auch Freundschaft geschlossen mit überlebenden Schopflocher Juden, auch deren Kindern und Kindeskindern, die sich in die ganze Welt verstreut haben. Ich denke, auch für Dich ist das eine Bereicherung?
A.B.: Das sind ja nicht nur die Schopflocher Juden, sondern auch Überlebende aus Dinkelsbühl, Wittelshofen und Feuchtwangen. Wie ich vorhin schon sagte, habe ich mit den vier Dinkelsbühlern einen sehr herzlichen Kontakt. Sie haben mir auch über ihr Leben erzählt, was ich aufgeschrieben und in meine Homepage gegeben habe. Sigrids Lebensgeschichte in fünf Konzentrationslagern und einem Arbeitslager durfte ich nach einundsiebzig Jahren in einer Gedenkveranstaltung im Jahr 2008 vorlesen. In ihrer Heimatstadt nach siebzig Jahren Anerkennung zu bekommen, endlich als Opfer wahrgenommen zu werden, wurde allerhöchste Zeit und war für sie sehr wichtig.
C.W.-F.: Nach Schopfloch kommen auch sehr alte Menschen aus dem Ausland und Du führst sie über den Friedhof und sie erzählen Dir beim Rundgang durch den Ort über ihre Familien. Auch andere, nichtjüdische Besucher, interessieren sich für den Friedhof und Du erzählst ihnen Geschichten. Hast Du ihnen auch über die lachoudische Sprache in Schopfloch erzählt?
A.B.: Die lachoudische Sprache in Schopfloch ist eigentlich für mich und meine Arbeit eine Randerscheinung . Über das Lachoudische haben Heimatpfleger Philipp und dann der Bürgermeister Hans-Rainer Hofmann ein Buch geschrieben. Ich denke, damit ist diese Arbeit gut erfasst und abgeschlossen. Natürlich erzähle ich, dass es diesen Dialekt im Ort gibt und erkläre die Herkunft. Noch heute sprechen ihn einige Bewohner im Ort, zum Teil noch recht flüssig. Diese Sprache ist ein Relikt aus der Zeit des christlich-jüdischen Zusammenlebens. Es war eine Händlersprache, die es nicht nur in Schopfloch auf dem Markt gab. Auch in anderen Gemeinden, wo Juden zuhause waren, wurde diese Sprache ins tägliche Leben übernommen.
C.W.-F.: Warum wird diese Sprache aber in Schopfloch so besonders hervorgehoben?
A.B.: Weil sie heute noch gesprochen wird, und die Begriffe sich in die Allgemeinsprache, in den Allgemeindialekt, eingeprägt haben.
C.W.-F.: Auch bei christlichen Bürgern Schopflochs?
A.B.: Oh, ja, es gibt alteingesessene Schopflocher Familien, in denen dieser Dialekt, diese lachoudische Sprache, von Generation zu Generation weitervererbt wird. Eine Händler- und Geheimsprache, die aus dem Hebräischen, aus dem Jiddischen und aus dem Rottwelsch entstand. Da „in Schopfloch nichts geheim bleibt“ wurde sie zum öffentlichen Dialekt. Eigentlich ein Sprachenmischmasch.
C.W.-F.: Dieser Sprachenmischmasch interessiert mich ganz besonders, zumal Du erwähntest, dass diese Sprache auch in anderen Dörfern gesprochen wurde. Auch erzähltest Du, dass ein Italiener darüber geschrieben hat. Wer war das?
A.B.: Ich habe an Primo Levi gedacht. Er beschreibt, dass in seiner Heimat bei Turin, in den ländlichen Gemeinden im südlichen Piemont, sich aus dem Italienischen und Jiddischen eine gemeinsame Mischsprache entwickelt hat und nennt in seinem Buch „Das Periodische System“ viele Wortbeispiele. So hat diese Sprache sich auch in anderen Ländern, in anderen jüdischen Gemeinden, entwickelt. Das Zusammenleben von Juden und Christen hatte dazu geführt
C.W.-F.: Für Dinkelsbühl und die umliegenden Dörfer hast Du durch Deine Freude an der Arbeit einen wichtigen Meilenstein zu ihrer Stadt- Dorf- und Kulturgeschichte gelegt. Jüdische Familiennamen, deren Berufe, Schicksale und Opfer werden erforscht und in die Gegenwart gebracht. Hat das auch für Dich zum Positiven geführt? Hat Deine Arbeit in Deiner heutigen, direkten Umgebung Nachhall gefunden?
A.B.: Ja, die Menschen in Schopfloch, die mir gegenüber offen sind. Eine alte Schopflocherin, deren Mutter eine jüdische Mitgefangene aus der Familie Herold pflegte, erzählte mir einiges. Hin und wieder habe ich im Ort Zeitzeugen gefunden, die mir aus der Vergangenheit, von damals, erzählt haben. Sie haben nichts beschönigt und von den Schattenzeiten in der Nazizeit berichtet. Ungerechtigkeit an Juden wurden beschrieben.
In Dinkelsbühl habe ich eine übergroße Resonanz bekommen als ich das Anbringen einer Tafel an der Synagoge initiiert habe. Damals bekam ich viele Anrufe von Dinkelsbühlern. Sie hatten das Bedürfnis aus der Nazizeit zu berichten.
C.W.-F.: Nichtjüdische alte Bürger berichten Dir heute noch von damals und was bedeutet das für Dich?
A.B.: Für mich haben sich dadurch wichtige Lücken gefüllt. Z.B. Fanny Benjamins Geschichte, von der ich gar nichts wusste. die ohne Stein beerdigt wurde. Mich hat das sehr bedrückt. Eine sehr alte Dame rief mich aus dem Altenheim an. Von ihr erfuhr ich, dass Fanny Benjamin sieben Jahre in ihrer Familie gelebt hat und wie die Endphase für die Juden, die bis 1938 hier geblieben waren, sehr schwierig wurde. Wie sie dann verschwinden mußten.
Fanny Benjamin wurde krank, kein Arzt kam. Ihre Schwester bat im Rathaus um Hilfe, doch Hilfe für das „Judenweib“ wurde verweigert! Von der Jüdischen Gemeinde wurde sie dann versorgt und starb schwerkrank nach zwei Wochen. Das sind wichtige Informationen für mich, um das damalige Elend der Juden begreifen zu können.
Über Paula Jordan, die auch ohne Stein beerdigt wurde, erfuhr ich einiges von einem anderen Zeitzeugen. Er hatte als kleiner Junge den Beerdigungszug noch bis zum Dorfende begleitet und er erinnerte sich sehr gut, dass diese Frau auch ohne Stein beerdigt wurde. Das war im Februar 1938.
C.W.-F.: Vorhin sind wir noch mal zusammen über den herbstlichen Friedhof gegangen und ich sah, dass nun zwei Grabsteine für diese beiden Frauen, über die Du gerade gesprochen hast, im Rasen liegen. Wieso jetzt, nach über 60 Jahren?
A.B.: Es war mir ein großes Bedürfnis. Ich habe in der Gemeinde nachgefragt, ob ich Steine legen darf. Geld habe ich dann gesammelt, den Rest gab ich dazu. Mit meiner Projektpartnerin, Birgit Hänlein-Heberlein, habe ich überlegt, was wir machen können. Wir haben uns dann auf die liegenden Steine geeinigt, weil wir keine große Veränderung des Friedhofsarrangements haben wollten. Auch wollten wir die Besucher darauf aufmerksam machen, dass hier nicht mehr drauf getreten werden darf. Hier liegt jemand, deshalb die schlichten Platten.
C.W.-F.: Ihr habt den beiden Frauen jetzt endlich ihre Namen gegeben, sie nach über sechs Jahrzehnten würdevoll beerdigt.
A.B.: Und die letzte Ehre haben wir ihnen dadurch auch erwiesen. Ihnen wurde ja damals ohne Stein und ohne Namen, die Würde genommen.
C.W.-F.: Der Dinkelksbühler Rotary Club hat Dich zu Beginn dieses Jahres mit einer hohen Auszeichnung bedacht. Die Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Frau Charlotte Knobloch, war bei der Preisübergabe dabei und Rabbi Ebert aus Würzburg. Das „gewonnene“ Geld hast Du dann gleich in die Grabsteinsanierung gesteckt.
A.B.: Das war natürlich vom Rotary Club auch so gedacht.
C.W.-F.: Du erwähntest gerade Rabbi Ebert. Hat er Dir nicht im letzten Jahr beim Entziffern der Namen geholfen?
A.B.: Damals habe ich ihn eingeladen und einen Nachmittag lang haben wir dann hier zusammen auf dem Friedhof gearbeitet, obwohl er ein sehr beschäftigter Mann ist. Ich freue mich immer, wenn Menschen aus Idealismus und Hilfsbereitschaft bei solchen Projekten mitmachen. Es gibt der Arbeit einen ganz anderen Geist. Rabbi Ebert war so begeistert von der Arbeit, dass er nicht nur zwanzig, sondern vierzig Steine entziffert hatte. Für mich war es selbstverständlich, dass er bei der Preisverleihung auch dabei war.
C.W.-F.: Trotz täglicher sehr heftiger körperlicher Schmerzen lässt Du Dich nicht entmutigen für den Schopflocher Jüdischen Friedhof zu kämpfen und zu streiten. Auch die Erinnerung an die jüdischen Familien in Schopfloch möchtest Du wachhalten, einfach daran erinnern, dass diese Familien einmal hier mit christlichen zusammengelebt und eine Dorfgemeinschaft gebildet haben.
A.B.: Wir reden hier immer über den Schopflocher Friedhof. Er war aber ein Verbandsfriedhof für mehrere Gemeinden. Dort, wo die Geschichte der Jüdischen Gemeinden noch nicht erforscht war, habe ich versucht, Lücken zu schließen. Feuchtwangen ist z.B. bestens erforscht durch die dortigen Heimatforscher, in Dinkelsbühl war diesbezüglich recht wenig geschehen. Da habe ich sehr viel aufgearbeitet und in Wittelshofen trug ich ganz einfach die Arbeit der beiden dortigen Heimatforscher zusammen zu einer Arbeit „Jüdisches Wittelshofen“. Alles habe ich dann ins Internet gesetzt, damit es eine historische Erfassung über Wittelshofen gibt.
Seit wann gab es Juden in Wittelshofen, was war in Wittelshofen zu finden, was gibt es heute noch, eben die Besonderheiten Wittelshofens. Der Anteil der jüdischen Bevölkerung war teilweise höher als in Schopfloch. Man nannte Wittelshofen das Judendorf. Es waren Bauern, Viehhändler, die eng miteinander verbunden waren. Dieses schöne Zusammenleben wurde durch das Judenedikt reduziert, aber natürlich auch durch den Nationalsozialismus. Juden durften dann bei den Christen nicht mehr einkaufen, also umgekehrte Verordnungen. Das Ende der Juden in Wittelshofen war besonders dramatisch. Die drei Familien, die dort noch lebten, wurden einen Tag vor der Reichsprogromnacht auf einen LKW verfrachtet und über Feuchtwangen nach Nürnberg gebracht.
C.W.-F.: Was geschah dann mit ihnen?
A.B.: Einige sind nach München gezogen und ein Ehepaar blieb in Nürnberg, die Weinschenks. Rose Weinschenks Mann starb 1940. Man weiß nicht warum. Die jüdischen Mitbürger wurden damals sehr unter Druck gesetzt. Sie sollten ihre Häuser verkaufen. Frau Weinschenk war die einzige in der gesamten Region, die sich weigerte bis zu ihrer Deportation ihr Haus zu verkaufen. Sie wollte es behalten! Das wird ein schrecklicher Druck gewesen sein, sogar unter Folter. Folter war damals üblich in Nürnberg. Rosa Weinschenk wurde dann deportiert und umgebracht. Ihr Cousin klagte nach dem Krieg auf Wiedergutmachung. Das Haus, das damals zwangsversteigert wurde, musste nun von der Gemeinde nochmals gekauft werden. Das ist für mich eine ganz besondere Geschichte. Rosa Weinschenk muß eine sehr tapfere Frau gewesen sein.
C.W.-F.: Trotz aller Tapferkeit ist sie dann doch umgebracht worden. Eine sehr traurige Geschichte!
A.B.: Ja, ein Opfer der Shoa, wie viele andere.
C.W.-F.: Sind von den Familien, über die Du mir erzählt hast, Überlebende in die Dörfer zurückgekehrt?
A.B.: In Dinkelsbühl kamen die Eltern der Ansbachers, Ludwig und Selma Ansbacher, aus Theresienstadt zurück. Sie wollten sich in ihrer vergangenen Stadt wieder ansiedeln, doch der Versuch ist missglückt. Viele Dinkelsbühler bekamen damals nach dem Krieg Endnazifizierungsbescheinigungen, sogenannte Persilschein. Das haben die Ansbachers einfach nicht verkraftet und sind in die USA gegangen. Wir verstehen sie nicht mehr und sie verstehen uns nicht, sagten sie damals. Die einzige Jüdin aus der gesamten Region, die zurückkam und blieb, war Jette Bär aus Mönchsroth. Sie kam aus Italien zurück und hat ganz selbstverständlich dann dort mit den Dorfbewohnern wieder zusammengelebt. Eigentlich ist das sehr erstaunlich, denn in Mönchsroth gab es sehr schlimme Vorkomnisse in der Nazizeit. Die letzten vier Juden, die dort lebten, wurden überfallen, ausgeraubt und körperlich misshandelt. Mönchsroth war also auch nicht zimperlich.
(Das Interview wurde 2009 geführt)

Angelika Brosig auf dem Jüdischen Friedhof in Schopfloch. Foto: Wollmann-Fiedler
Für Angelika Brosig der Erhalt des Jüdischen Friedhofes und die Erinnerung an die Jüdischen Familien im Ort zur Lebensaufgabe geworden. Im Januar 2010 wurde ihr im Abgeordnetenhaus in Berlin der hochangesehene Obermayer German Jewish Community History Award überreicht. Dr. Obermayer war persönlich aus den USA angereist und überreichte ihr und noch vier anderen Damen und Herren diese Auszeichnung. Eine große Ehre, eine hohe Auszeichnung für Angelika Brosigs engagierte Arbeit.

Angelika Brosig erhält den Obermayer German Jewish Community History Award. Foto: Wollmann-Fiedler
Weniger körperliche Schmerzen wünsche ich Angelika Brosig für die Zukunft und viele Geldspenden zum Sanieren der Friedhofssteine auf dem Schopflocher Friedhof (2010). 2013, starb Angelika Brosig mit 47 Jahren an ihrer schweren Krankheit.

Der Jüdische Friedhof in Schopfloch. Foto: Wollmann-Fiedler
Das Interview habe ich im Jahr 2010 mit Angelika Brosig in Schopfloch aufgenommen.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende, oder werden Sie Mitglied der Israel-Nachrichten.
Durch einen technischen Fehler, ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet!
Leserkommentare geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Wie in einer Demokratie ueblich achten wir die Freiheit der Rede behalten uns aber vor, Kommentare nicht, gekuerzt oder in Auszuegen zu veroeffentlichen. Anonyme Zuschriften werden nicht beruecksichtigt.