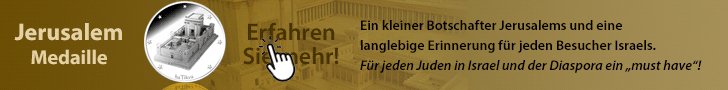
Bei Lukas 10; 25 ff findet man die Geschichte vom „Barmherzigen Samariter“, aber gibt es sie heute noch?
Vor der Zerstörung des ersten Tempels in Jerusalem im Jahr 587 BCE lebten einige Tausend Samariter, oder, wie sie sich selber nennen „Shomronim“ (= Wächter) im damaligen nördlichen Königreich Israel. Die Truppen Nebukadnezars hatten das eher arme unfruchtbare Gebiet wohl für nicht wertgehalten, von ihnen erobert zu werden und die dort lebenden Menschen mit ins Exil zu nehmen.
Während sich Juden im Exil in Babylon weiter entwickelten, dort den Talmud Babli entwickelten und schrieben und sich wirtschaftlich und sozial durchaus in die babylonische Gesellschaft integrierten, verharrten die Shomronim in ihren alten Strukturen. Und so können sie mit Fug und Recht und auch mit Stolz von sich sagen, dass sie heute die Juden sind, die sich ihre ursprüngliche Lebensform, Religion und Kultur seit über 3000 Jahren unverändert erhalten haben.
Heute ist die Gemeinschaft wieder auf knapp 800 Menschen angewachsen. Etwa die Hälfte von ihnen lebt nach wie vor in Samaria in der Nähe von Nablus, dem ehemaligen Shchem, im Dorf Kiryat Luza. Bis in die 80er Jahre hinein lebten sie in Nablus selbst. Während der zweiten Intifada kam es immer wieder zu Ausschreitungen und Übergriffen durch die arabischen Nachbarn, so dass sich die israelische Regierung entschloss, für sie ein neues Dorf zu bauen. In Nablus erinnert nur noch eine verlassene Synagoge an die ehemalige samaritanische Gemeinde.
Um dem drohenden Ende der Gemeinschaft entgegen zu steuern, beschlossen die Priester, einen unkonventionellen Weg zu gehen. Statt der bis anhin strikten Vorgabe, nur innerhalb der Gemeinschaft zu heiraten, gestattete man, dass Männer auch jüdische Frauen heiraten dürfen, die nicht zu den vier grossen Familienclans gehören. Vor der Hochzeit gibt es eine „Probezeit“, um sicherzustellen, dass die Frau, die nicht formell übertreten muss, auch bereit ist, sich den strengen Regeln der Religion zu unterwerfen. Frauen sind grundsätzlich gleichberechtigt und frei in ihren Entscheidungen. Man legt grossen Wert darauf, dass sie eine optimale Bildung, oftmals bis in den akademischen Bereich erfahren. Da mutet es vielleicht anachronistisch an, wenn sie, wie ihre Ahninnen, während der Tage der „Nida“, der Menstruation, von der Gesellschaft abgeschirmt leben. Einige Frauen erleben dies als Erniedrigung, andere sind froh über die Tage, die sie nur für sich haben. (Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, dem empfehle ich das Buch „Das rote Zelt der Frauen“ von Anita Diamant, das die Geschichte von Dina, der Tochter von Lea und Jakob erzählt).
Andere Frauen halten den Druck nicht aus, konvertieren zum Judentum und heiraten, so wie Sofi Tzadka, die heute als Schauspielerin und Sängerin lebt, verheiratet ist und zwei Kinder hat.

Gebete am Berg Garizim. Foto: E. Scheiner
Hochzeit und Scheidung werden von einem der Priester durchgeführt und werden durch das israelische Innenministerium anerkannt. Das tönt immerhin nach einer partiellen Anerkennung ihres Sonderstatus innerhalb des Judentums.
Sie sehen sich als direkte Nachfahren Jakobs (der später Israel hiess) und somit als „Kinder Israels“ an. Immerhin war der Geburtsort Jakobs, dem Vater der zwölf Stämme, Shchem. Als die Hebräer aus dem babylonischen Exil zurückkehrten und damit begannen, den zweiten Tempel in Jerusalem aufzubauen, wollten die Shomronim ihnen bei den Bauarbeiten helfen. Sie wurden mit der Begründung abgewiesen, dass sie vom Glauben Abgefallene seien. Diese Kränkung führte zum dramatischen bis heute nicht verheilten Bruch.
Hier auf die Unterschiede zwischen den Shomronim und den anerkannten Juden einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Sie sind sich so ähnlich und doch so anders. Alle Riten, alle Bräuche sind vertraut und doch verwirrend. Gleiches gilt aber auch für die Bnei Israel aus Indien, für die Jemeniten und Karäer, um drei Beispiele zu nennen.
1954 förderte der damalige israelische Präsident Yitzhak Ben-Zvi die Ansiedlung einer zweiten Gruppe in Holon, einer modernen Stadt südlich von Tel Aviv. Er befürchtete eine Zersiedlung der kleinen, in seinen Augen sehr schützenswerten Gemeinschaft, wenn ihnen kein gemeinsames Wohngebiet angeboten würde.
Jede Familie, die in Holon lebt, verfügt zusätzlich über eine Wohnung oder ein Haus in Kiryat Luza. Es wird erwartet, dass während Pessach und Shavuot die gesamte Gemeinschaft in den Bergen lebt und auf ihrem Heiligen Berg, dem Garizim betet. Hier, so wussten die Shomronim, baute Josua im Auftrag von Moses den Altar, dem um 400 BCE der Tempel folgte. 1964 gaben Grabungen die Überreste der Tempelanlage frei und stützten damit die Überzeugung der Shomronim und belegten die Spuren der Geschichte.
Die Teilung der Shomronim in zwei Gruppen hat ganz pragmatische Folgen: Jene, die in Holon leben, erhalten nur den israelischen Pass und nehmen nur an den Wahlen zur Knesset teil. Sie müssen den Militärdienst absolvieren. Für alle anderen, die in Kiryat Luza leben, gibt es keinen verpflichtenden Militärdienst. Sie verfügen über die palästinensische und israelische Doppelbürgerschaft, und sind auch doppelt wahlberechtigt. Dass sie allerdings ihrer Wahlberechtigung in Israel kaum nachkommen, hat weniger damit zu tun, dass sie sich dem Staat nicht verpflichtet fühlen, sondern, dass das Wahllokal in der benachbarten jüdischen Gemeinde ist. Um dorthin zu kommen, müssen sie palästinensisches Gebiet durchqueren. Eine hohes Fahraufkommen am Wahltag könnte die fragile Ruhe zwischen ihnen und ihren Nachbarn stören. Und das wollen sie natürlich vermeiden. „Wir fühlen uns den Juden verbunden, denn unsere Religionen ähneln einander. Gleichzeitig fühlen wir uns den Palästinensern verbunden, denn wir leben mit ihnen, arbeiten mit ihnen und unsere Kinder gehen auf ihre Schulen.“
In Kiryat Luza ist die Muttersprache Arabisch. Und Hebräisch mit starkem arabischen Akzent. In Holon ist die Muttersprache Hebräisch. Und Arabisch mit starkem hebräischen Akzent.
Die geografische Lage ihres Wohnortes ist nicht unbedingt dazu angetan, den Bewohnern das Leben zu erleichtern. Entsprechend den Oslo-Verträgen von 1993 liegt Garizim, der Mittelpunkt ihres religiösen Lebens in der von Israel kontrollierten Zone C, das Dorf selber liegt in Zone B. Diese wird von Israel und Palästina gemeinsam kontrolliert. Die Strasse schliesslich, die vom Dorf nach Nablus hinunterführt, liegt in Zone A, und damit innerhalb des palästinensischen Oberhoheitsgebietes.
Dass auch Namen leicht zu Missverständnissen führen können, musste ein 21 Jähriger erleben, als er an der Strassenkreuzung von Kiryat Luza (Zone A) aus einem palästinensischen Auto stieg und sich zu Fuss auf den Heimweg (Zone B) machte. Er wurde von Sicherheitskräften angehalten und musste sich ausweisen. Der Name auf der palästinensischen ID verunsicherte den Soldaten sehr: Abdullah Cohen. Ein Anachronismus, den man in dieser Form nur hier findet.
In den vergangenen Tagen, während Sukkot nutzten viele Besucher die Chance, einen kurzen Blick auf das Leben der Shomronim zu werden. Seit vor einigen Jahren die liebevoll geschmückten Laubhütten vor den Häusern verschmutzt und sogar zerstört worden waren, hat man sich darauf geeinigt, diese innerhalb der Häuser aufzustellen. Selbstverständlich genau entsprechend den Vorschriften.
Abdullah Wasef Tawfiq, der Hohepriester, mit dem bodenlangen rituellen Gewand, dem weissen Turban (für alle anderen Männer ist die Kopfbedeckung ein roter Fez) und seinem langen weissen Bart sieht wirklich aus, als sei aus der Zeit gefallen.
Den palästinensischen Mitarbeitern seiner Tehina Fabrik gibt er einen kurzen Lehrvortrag über die Religion der Shomronim, kurz darauf plaudert er mit einer Gruppe junger Israelis aus einer benachbarten Siedlung. Sie tragen ganz dem Klischeebild des Siedlers entsprechend Shorts. Die allgegenwärtige Waffe wird selbstbewusst am Gürtel getragen. Mitglieder der IDF schauen vorbei, sogar einige Offiziere sind unter ihnen. Palästinensische Familien haben den Weg gefunden, Vorsitzende vom jüdischen Siedlerrat unterhalten sich ungezwungen mit ihnen. Sogar der Gouverneur von Nablus ist gekommen, um seine Feiertagswünsche zu überbringen.
Manche Männer tragen an den Feiertagen quietschbunte Kaftane. Sie sollen an das bunte Kleid erinnern, das Josef von seiner Mutter erhielt und trug, als seine Brüder seinen Tod vorgaben, ihn aber tatsächlich verkauften.
Einig sind sie sich alle im Respekt, den sie dem Hohepriester entgegenbringen. Yossi Dagan, der Vorsitzende des Siedlerrates und Akram Rajoub, der Gouverneur haben aber dennoch ganz unterschiedliche Vorstellungen über die Zugehörigkeit der Shomronim: „Ich sehe sie als meine Verwandten, ja sogar als Brüder.“ So die jüdische Haltung. „Die Samaritaner sind ein Teil des palästinensischen Volkes.“ So lautet die pragmatische Stimme aus Palästina.
Und sie selber? Sie sehen sich als Brücke. Und machen einen Anfang im Caféhaus „Zum Guten Samariter”, in dem der Name Programm zu sein scheint. Hier kommen alle gerne hin, Touristen und Einheimische. Aber auch Palästinenser, um heimlich ihr Feierabendbier zu kaufen.
Von Esther Scheiner
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende, oder werden Sie Mitglied der Israel-Nachrichten.
Durch einen technischen Fehler, ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet!
Leserkommentare geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Wie in einer Demokratie ueblich achten wir die Freiheit der Rede behalten uns aber vor, Kommentare nicht, gekuerzt oder in Auszuegen zu veroeffentlichen. Anonyme Zuschriften werden nicht beruecksichtigt.