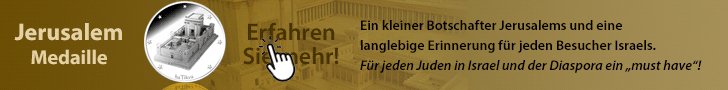
Der Verlust der Existenz, die Demütigungen – besonders der Väter – durch das Nazi-Regime und die Trennung der Familien hatten weitreichende Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Flüchtlinge und ihre Rollen im Familienverband. Unbeschreiblich glücklich war Stella Hershan, als sie nach ihrer Flucht aus Österreich bei Elizabeth Arden einen Job in New York als Verkäuferin fand.
Zum ersten Mal in ihrem Leben verdiente die bisher sehr verwöhnte Tochter aus „gutem Hause“ ihr eigenes Geld. Mit einem Foto in ihrer Manteltasche begab sie sich dann wenig später auf Arbeitssuche für ihren Ehegatten und war – obgleich von Freunden belächelt – dabei erfolgreich. In Palästina teilte Anna Rattner ihren verzweifelten, arbeitslosen Ehemann zur Hilfsarbeit in ihrer Schneiderei ein. In Wien hatte sie ihr Gehalt als Verkäuferin in einem großen Modesalon verdient, in Tel Aviv produzierte sie mitten im Zweiten Weltkrieg sehr erfolgreich verspielte Wiener Mode.
Nach einer dramatischen Flucht und einer langen Irrfahrt im Mittelmeer bezeichnete sie ihre Emigration als die „sieben fetten Jahre“. Nie zuvor und nie mehr danach war sie für den Erhalt der Familie verantwortlich, und nie mehr wieder war sie „Chefin.“ Flucht und Vertreibung erlebten Männer und Frauen sehr unterschiedlich – trotz vieler gemeinsamer Erfahrungen, beispielsweise des Verlustes von Heimat und Sprache, des sozialen Abstiegs und der Trennung von Mitgliedern der Familie. Bereits vor der Flucht, mit der Verhaftung vieler jüdischer Männer, sahen sich Frauen gezwungen, aus ihren herkömmlichen Rollen auszubrechen: Sie verhandelten mit nationalsozialistischen Behörden, standen vor Konsulaten Schlange und organisierten Visa und Schiffskarten. Da sich Frauen wesentlich weniger über berufliche Aktivitäten und Erfolge definierten, erwiesen sie sich in extremen Situationen mitunter anpassungsfähiger als ihre Männer und manchmal auch kreativer im Erfinden von Jobs.
Doch nicht immer fiel es ihnen leicht, mit dieser mehr oder weniger erzwungenen Emanzipation umzugehen. Eine Neudefination der Männer- und Frauenrollen konnte auf beiden Seiten zu Unsicherheiten führen. Während das neue Leben in der Emigration trotz aller traumatischen Erfahrungen bei Frauen auch zu einem neuen Selbstbewusstsein beitragen konnte, geriet bei Männern das Selbst- und Rollenverständnis durch den Verlust ihrers Berufes und somit ihrer Rolle als Ernährer häufig massiv ins Wanken. Viele reagierten mit Verunsicherung, Scham und oft auch aggressiven Verhalten gegenüber ihren – meist unfreiwillig – selbständig gewordenen Frauen.
Die Bereitschaft, schnell unqualifizierte Arbeit anzunehmen, um das Überleben der Familie zu sichern, konnte Frauen aber auch zum Verhängnis werden. Eindrucksvoll schilderte einst die renommierte Berliner Ärztin Hertha Nathoff in ihrem Tagebuch, wie sie in New York als Küchenhilfe und Krankenschwester arbeitete, damit ihr Ehemann sich auf die für Ärzte notwendige Prüfung vorbereiten konnte. Und sie betont auch, wie sehr es ihren Mann demütigte, von ihrem Verdienst leben zu müssen. Doch letztendlich konnte er seine Praxis wider eröffnen, mit seiner Gattin als Sprechstundenhilfe, der jetzt die Kraft für die eigene Prüfung fehlte.
Wie schnell sich die Flüchtlinge und Emigranten auf die neuen Bedingungen des Aufnahmelandes einstellten, hing nicht zuletzt vom Lebensalter und Geschlecht des Betroffenen ab. Junge Menschen stellten sich leichter auf die neue Situation ein, sie zeigten sich offener und dem Fremden gegenüber, weniger ängstlich als ihre Eltern und erlernten vor allem schnell neue Sprachen. Manche bezeichneten ihre Emigration sogar als großes Abenteuer, als eine Zeit, in der sie viel Spaß hatten, jung und erstmals verliebt waren. Dennoch prägten Vertreibung und Emigration massiv ihr Leben und nicht zuletzt ihre Beziehung zu den Eltern. Kinder mussten ansehen, wie ihre Väter von den Nazis gedemütigt wurden und ihrer Schutzfunktion gegenüber der Familie nicht mehr nachkommen konnten. Väter kamen vollkommen gebrochen und verändert aus Konzentrationslagern zurück; – soweit man sie entlassen hatte.
In den Emigrationsländern konnte häufig auch eine Umkehr der Rollen beobachtet werden: Kinder litten an der Desorientierung ihrer Eltern und „übersetzten“ ihnen die neue Welt. Jugendliche übernahmen sehr oft auch die Funktion des Ernährers, was beim bereits durch die Nazis gebrochenen Vaters zum Gefühl der völligen Entmachtung beitrug.
Zu den wohl traumatischsten Erfahrungen gehörte die Verschickung im Rahmen eines Kindertransportes. „Am 10. Mai 1939 früh fuhr Rudi nach England ab“, mit diesem Satz begann der Arzt Theodor Friedrichs die Schilderung über den herzzerreißenden Abschied von seinem Sohn am Schlesischen Bahnhof in Berlin. Wie sich Doktor Friedrichs erinnerte, mussten sich die Eltern bereits im Wartesaal des Bahnhofs von ihren Kindern verabschieden, denn „wenn man sieht, wie der Zug anfährt und langsam das Liebste, was man hat, für lange Zeit, für manche für immer, in die Ferne trägt, so ist das erschütternder als ein kurzes Losreißen.“
Als England nach dem Novemberpogrom 10.000 Kinder aus Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei aufnahm und auf Familien im ganzen Land verteilte, wurde Eltern wie den Friedrichs die äußerst schwierige Entscheidung abverlangt, darüber zu entscheiden, ob sie ihr Kind retten wollten, indem sie es ganz allein in ein fremdes Land zu völlig fremden Menschen schickten. Kinder wiederum fühlten sich von ihren Eltern im Stich gelassen und hatten durch diese abrupte Verschickung oft jegliches Vertrauen in die Menschen verloren. Unter dem massiven Druck der poltischen Verhältnisse schickten Eltern ihre Kinder nicht nur nach England, sondern auch nach Palästina, das seit dem Jahre 1922 offiziell von Großbritannien als Völkerbundmandat verwaltet und sowohl von Arabern als auch von Juden als Heimstätte beansprucht wurde. Auf der Fahrt wurde den Kindern von zionistischen Organisationen oft vermittelt, dass sie in ihre ursprüngliche Heimat, ein Land von Milch und Honig, heimkehren würden. Doch die Realität erwies sich als wesentlich anders. Vielen blieb nachhaltig in Erinnerung, wie sie nach ihrer Ankunft im Hafen von Haifa in kugelsichere Autobusse verfrachtet und auf Kibbuzim verteilt wurden. Sie hatten oft keine Ahnung davon, dass in diesem Land auch Araber lebten, die sich seit 1936 im Aufstand befanden. Neue hebräische Namen sollten ihnen helfen, das in Europa erlebte so schnell wie möglich zu vergessen und ihre Umwandlung von bürgerlichen Jungen und Mädchen in wehrhafte Bauern beschleunigen.
Ari Rath, der langjährige Herausgeber der „Jerusalem Post“ erinnerte sich, dass ihm als erste Aufgabe im Kinder- und Jugendheim „Ahava“ (Liebe) die Reinigung der Jauchegrube zugeteilt wurde. Er verschwieg auch nicht, dass einzelne seiner Altersgenossen auf die Trennung von den Eltern und das harte und ungewohnte Leben mit massiven psychischen Problemen reagierten.
Sehr wenig wissen wir bisher von jenen Kindern, die von ihren politisch engagierten Eltern in Kinderheime, Klöster oder zu Zieheltern nach Moskau verschickt wurden. Sie wollten ihre Kinder in Sicherheit bringen, um selbst ungestört der politischen Arbeit nachgehen zu können. Die Kinder hatten für dieses poltische Engagement zumeist sehr wenig Verständnis, fühlten sich hilflos und alleine gelassen. Manche können diese Entscheidung ihren Eltern bis heute nicht verzeihen. Während das Ehepaar Friedrichs nach seiner Emigration nach Shanghai zumindest einige Jahre später den Sohn in die Arme schließen konnte, warteten viele Kinder, denen die Flucht gelungen war, nach der Shoa vergeblich auf ihre Eltern. Und auch das Zusammentreffen war nach vielen schwierigen Emigrationsjahren nicht immer einfach. Eltern und Kinder hatten sich – so sie überlebt hatten – auseinandergelebt, Kinder hatten oft die Muttersprache verlernt oder sich von ihrem jüdischen Milieu entfremdet.
Und heute? Jetzt sterben die Kinder und Enkel der Shoa-Überlebenden im Kugelhagel der Hamas-Terroristen; aber das versteht der Westen nicht – will es nicht verstehen.
Von Rolf von Ameln
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende, oder werden Sie Mitglied der Israel-Nachrichten.
Durch einen technischen Fehler, ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet!
Leserkommentare geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Wie in einer Demokratie ueblich achten wir die Freiheit der Rede behalten uns aber vor, Kommentare nicht, gekuerzt oder in Auszuegen zu veroeffentlichen. Anonyme Zuschriften werden nicht beruecksichtigt.